von Stefan Petermann
Weimar. 13.4. | Ernstfalltest

Der erste Wurf. Der Auftakt soll in Weimar stattfinden, dort, wo wir leben. Für den Anfang gehen wir nicht hinaus auf Marktplätze und in Fußgängerzonen, wollen nicht den Zufall entscheiden lassen, mit wem wir über Wut sprechen. Wir laden Freunde, Bekannte, erweiterte Bekannte ein. Das soll helfen, das, was wir bisher nur in Gedanken gebaut haben, in der Wirklichkeit zu beschauen. Eine Art Ernstfalltest, aus dem wir lernen wollen.
So ist die Wiese, auf der wir ab zehn Uhr an einem Sonntag sitzen, ein geschützter Raum. Die Menschen, die wir treffen werden, sind uns grundsätzlich wohlgesonnen. Wir müssen keine Übergriffigkeiten, keine Eskalationen befürchten, keine außer Kontrolle geratene Wut. Wir stellen uns gesittete Gespräche über den Zorn vor, Feldforschung in vertrautem Terrain.
Nun ist das vielleicht simuliert, feige, könnte man sagen. Man könnte auch sagen: Es ist der schwerste Anfang von allen. Was ist, wenn wir Gedanken erfahren, von denen wir besser nicht gehört hätten? Wollen wir wirklich wissen, was die Menschen, die sich in weiterem Umfeld von uns befinden, im Inneren umtreibt? Womöglich von Abgründen hören, Positionen, die unvereinbar sind mit unseren Überzeugungen? Was, wenn das Reden über die Wut eine Bruchlinie bewirkt, die es uns zukünftig unmöglich macht, miteinander umzugehen? Ist es nicht viel leichter, Abgründe von Fremden zu erfahren?

Wir bauen auf, richten ein: einen Tisch, eine Bank, mehrere Stühle, einen Teppich, die Wuttafel (noch haben wir kein Wort für das Objekt, das uns ein Tischler gezimmert hat), Kreide, einen von Yvonne gepflückten Blumenstrauß, einen künstlichen Blumenstrauß, Wasserflaschen, Gläser, Datentabellen, Notizhefte, Stifte, ein Audioaufnahmegerät, Mikrofon.
Wir lassen uns auf einer Wiese in Weimar Nord nieder. Stadteinwärts ein Wohngebiet, darüber ein Gewerbegebiet, dazwischen das Gras. Fußballplatz mal, nebenan eine Turnhalle, eine alte Schule, die heute als Asylheim genutzt wird. Es ist Mitte April, hat über zwanzig Grad, blauer Himmel. Die Sonne wird den ganzen Tag über brennen und den, der sich nur nachlässig eingecremt hat, die Haut tagelang schmerzhaft rot werden lassen. Mich zum Beispiel.

Was schnell auffällt: Die Wutinstallation wirkt idyllisch. Wie ein Sonntagspicknick im Grünen mit Blumen. Entspanntes Sitzen, achtsames Entschleunigen. Eine seltsame Ambivalenz ergibt sich so, vielleicht ein notwendiger Widerspruch. Würde es regnen, würde ein scharfer Wind gehen, wäre es dunkel und grau, wie wäre sie dann, die Wut in Worten?
Yvonne hat den Angefragten Zeitfenster zugewiesen. Eine halbe Stunde pro Person haben wir vorgesehen. Die ersten kommen zu zweit. Und brechen gleich dreifach unsere Regeln:
Sie bringen eigene Blumensträuße mit.
Sie schreiben nicht nur an die Tafel, was sie wütend macht, sondern auch etwas, das sie für sinnvoll halten.
Sie werfen keine Blumen. Sie legen sie nieder.

Das ist okay. Wir wollen einen Rahmen geben und was darin geschieht, soll frei sein. Das ist die Idee. Dennoch fühlt es sich ungut an, gleich zu Beginn das Ziel unterlaufen zu sehen. Was, wenn niemand Wut empfindet? Oder bereit ist, sich auf das Spielerische einzulassen?
Später dann ein Ineinandergreifen von Wut und Lösung. Eine Teilnehmende zählt auf, was sie wütend macht. Es sind regionale Beobachtungen: Totholz, die trockenen Äste an Bäumen, die brechen und auf Passanten fallen könnten, Behörden, die sich nicht darum kümmern. Noch während wir im Gespräch sind, taucht der nächste Teilnehmer auf. Er ist Ortsteilbürgermeister. Er hört von ihrer Wut, lässt sich die Orte mit dem Totholz beschreiben, nennt Gründe, weshalb Behörden nicht reagieren, schlägt vor, was zu tun wäre. Der Hilflosigkeit, mit der Wut einhergeht, wird Hilfe geboten. Irgendwie gut, etwas Konstruktives zu erleben.

Gegen sechs am Abend wird das Licht mild. Wir ahnen, dass auf den Grills im Wohngebiet nun das erste Fleisch liegt. 16 Personen waren hier, 16 Gespräche, 12x Wut mit Kreide, 10 Blumenwürfe. Hundert Fotos, tausende Worte. Material, viel zu viel Material, um schon ein erstes Fazit ziehen zu können. Vielleicht Erleichterung darüber, dass es keine Eskalation gab, wenig Abgründe. Oder Enttäuschung deshalb? Jedenfalls Erschöpfung. Vieles schwirrt uns im Kopf, die Gespräche verschwimmen ineinander. Wir halten uns an einzelnen Schlagwörtern fest; Hilflosigkeit, Ohnmacht, Demokratie, Despoten.
Den Tisch, die Tafel, die Bank, alles räumen wir zurück. Der Nacht bricht an, die ersten Blumen sind geworfen, wir fühlen uns, trotz all der Fragen, die neu hinzugekommen sind, bereit, die Wiese zu verlassen, hinauszufahren ins Unvertraute.
Pößneck. 26.5.2024 | Nahe der Hüpfburg

Nachdem wir den nächsten, geplanten Wurf krankheitsbedingt ausfallen lassen mussten, findet heute nun unser zweiter Wurf statt, mit großem Abstand zum ersten. Nach Pößneck wollen wir, auf die Orla-Saale-Schau. Raus aus dem sicheren Raum und doch irgendwie weiterhin ein gesicherter Ort. Zumindest nehmen wir das von der Schau an. Kompetenzthemen der Messe dort sind: Bauen & Sanieren, Garten von A–Z, Energiesparen, Mobilität & Auto, Spaß & Fun. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Mutzbraten und Champignonpfanne. Vormittags verfolgen Eltern stolz das Tanzen ihrer Beatbienenkinder auf der Bühne, am Nachmittag singt ein Alleinunterhalter Hulapalu und Cordula Grün auf dem Akkordeon.
Wir erhalten einen Platz in der Nähe der Hüpfburg, unserem Stand gegenüber das Rote Kreuz. Das Blaulicht der Einsatzwagen feuert die Zeit über durch. Wir haben eine überraschend lange Liste angelegt mit Dingen, wie wir für den Wurf brauchen. Diese hinzutragen und aufzubauen, dauert seine Zeit. Dann sitzen wir, es ist 9.45 Uhr, die Sonne brennt wie im April und merken gleich, dass es diesmal anders ist.

Diesmal kommen die Werfenden nicht zu uns, weil wir sie anfragten und in Slots einteilten. Diesmal müssen wir die potentiellen Werfenden zu uns locken. Wir haben ein Roll-Up aufgestellt und mit Steinen beschwert. »Sie sind wütend?« steht darauf, hoffentlich groß genug. Postkarten sind ebenfalls ausgelegt. Ein Mann setzt sich gleich zu uns, erfreut darüber, dass Yvonne ihn ansprach. Wut empfindet er, wenn Menschen ihre Umwelt dreckig zurücklassen, die Unsauberkeit. Er hat kein Zuhause, schläft im Obdachlosenheim von Pößneck. Wir reden weniger über die Wut, fragen stattdessen nach seiner Situation, nach seiner Vergangenheit, der DDR, was sich geändert hat, warum.
Mir fällt das nicht leicht. Ich bin auf Wut eingestellt und nun sitzt mir gegenüber jemand, der sagt, dass er abgesehen von Unsauberkeit keine Wut auf etwas empfindet und von seinem Leben spricht, das kein leichtes ist.
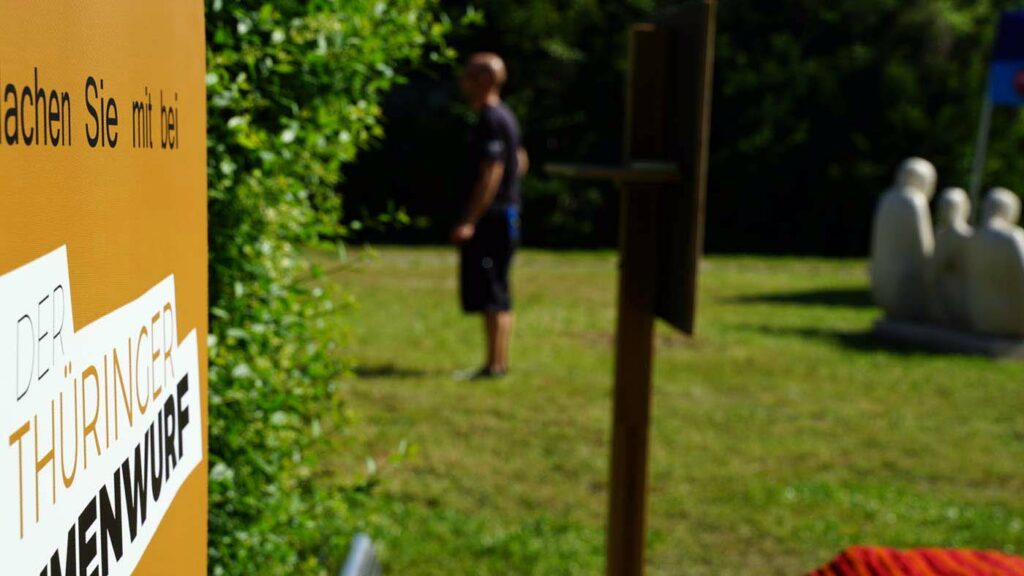
Ähnliches wird an diesem Tag mehrmals passieren. Die Gespräche über Wut, über Politik, Reflexionen sind zu führen. Wenn das Reden auf private Wut kommt, auf die persönlichen Schieflagen des Lebens, auf Wut in Familien, auf Tragik und Tod, da gerät die Idee, mit der wir hinausgefahren sind, ins Wanken. Dann fällt es schwer, dies als Teil einer Kunstaktion zu sehen, als Performance.
So war es nicht angedacht und trotzdem ist es da. Dann ist unser Angebot, über Wut zu sprechen, ein Angebot, grundsätzlich zu sprechen. Vielleicht über etwas, das sonst kaum geteilt werden kann. Dann sitzen da zwei Fremde, die mit Aufnahmegerät, Sonnenbrillen und Kameras sammeln wollen. Der Obdachlose will nicht werfen. Im Grunde bin ich froh, dass er uns damit die Entscheidung abnimmt, ob wir ihn bildlich in unser »Projekt« einreihen. Das Gespräch, das lässt er uns.

Danach beginnt die Schau so richtig. Menschen, viele Familien mit Kindern, strömen aufs Gelände. Man hat vielleicht schon kommunal gewählt, jedenfalls liegt fast der Mutzbratzen auf der Zunge und die Kinder springen auf der Hüpfburg und die Sonne scheint schön an diesem Maisonntag. Und dann steht da ein Banner und fragt »Sind Sie wütend?« Selbst, wenn man es ist, dann vielleicht jetzt gerade nicht. Jetzt ist Sonntag.
Wir merken das. Yvonne spricht unbeirrt die Vorbeischlendernden an. Viele lehnen gleich ab. Bei einigen älteren Paaren zeigt mehrmals die Frau Interesse. Der Mann jedoch nicht. Der Mann sagt etwas wie »Das wollen wir nicht« und obwohl die Frau vielleicht wollen würde, spricht der Mann für sie und sie läuft weiter, als ihr Mann läuft.

Doch wenn uns Gespräche gelingen, ist das ein Hauptgewinn. Jemand, der Wut auf Verantwortungslosigkeit empfindet und sagt, dass viele sich aus der Verantwortung stehlen und die lieber an einen starken Mann delegieren wollen und dieser Umstand vielleicht auch die Wahlergebnisse erklärt, die man allgemein für heute in Thüringen erwartet. Und weil ihn das stört, kandiert er heute für den Stadtrat in Pößneck. Eine Frau, die Wut auf Kriegstreiber hat. Die sehr ausführlich über Migration als Problem spricht. Und die betont, dass sie niemals die AfD wählen würde, der Vater ihres Manns war in Buchenwald, solche dürfen nie wieder an die Macht kommen, sagt sie.
Das fällt auf: Alle, die sich zum Sprechen hinsetzen, betonen ausdrücklich, dass sie niemals für die AfD stimmen würden. Dabei würden wir gern mit deren Wähler und Wählerinnen ausführlicher sprechen. Manche bleiben stehen, werfen kurze Sätze zu uns, deren Inhalt eine Parteienpräferenz nahelegen könnte. Aber ausführlicher über Wut wollen sie nicht reden, zumindest nicht hier, nicht heute, nicht mit uns.

Am späten Mittag besucht der Landrat des Saale-Orla-Kreises die Saale-Orla-Schau. Christian Herrgott weiß vom Blumenwurf. Weshalb er das tut, erfahren wir drei Stunden später. Eine halbe Stunde sprechen wir mit ihm. Wir haben noch die Stimmen der vorherigen Gespräche im Kopf, die sein politisches Handeln lobten und kritisierten. Er selbst verspüre keine Wut, sagt er, und lässt sich vor der leeren Tafel fotografieren. Zum Symbol des Blumenwurfs hat er, der 2020 im Landtag saß, eine klare Meinung; kalkuliert war die Aktion und geschadet hat sie den Institutionen, der Demokratie im Allgemeinen. Stunden vorher sagte jemand: Susanne Hennig-Wellsow hätte damals keine Blume werfen sollen, sondern ein ganzes Blumenbeet.
Und das ist dann das Nebeneinander von sehr unterschiedlichen Lebensläufen, von Ansichten, die alle begründet werden uns gegenüber, ruhig, man tauscht sich aus und in unseren Köpfen montieren wir die Aussagen miteinander, versuchen, so ein Bild zu zeichnen. Wir bauen ab, über eine Stunde später als geplant, hören kurz dem Akkordeonspieler zu und brechen dann auf zum zweiten Termin an diesem Tag.
Schloß Burgk. 26.5.2024 | Unter Polizeibeobachtung

Eine halbe Stunde von Pößneck entfernt liegt Schloß Burgk. Wir kennen den Ort vom Vorgängerprojekt, haben hier viel Zeit gebracht, darüber geschrieben, mehrere Ausstellungen gehabt, auch der Blumenwurf soll im nächsten Jahr im Gemäuer als Installation gezeigt werden.
Wir sind spät dran, zu spät. Und das Erste, was wir erfahren: Die Polizei weiß Bescheid, dass wir hier Blumen werfen lassen. Vor einer Woche war in der Nähe ein Fest des Bündnisses Dorfliebe für alle. Wir erfahren, dass dort »die AfD-Trommler« auftauchten. Nun ist man gewarnt, will ein ähnliches, bedrohliches Szenario vermeiden. Deshalb wurde der Wurf in der Dienstbesprechung des Landrats besprochen, deshalb wusste der Landrat von einer möglichen Gefährdungslage.

Es wird nichts passieren in dieser Richtung an diesem Tag. Wir führen sehr unterschiedliche Gespräche, Wut auf antirussische Propaganda, Wut über Rassismus. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen, wir sitzen im Burghof, die dicken Mauern halten die Hitze fern, der Blick geht auf das Tal, die Talsperre, der weite Blick ins Thüringer Land.
Hier ist die Bereitschaft gering, sich über Wut auszulassen. »Dafür ist zu wenig Platz auf der Tafel« wird uns von Vorbeilaufenden gesagt. Aber sie schreiben nicht. Deshalb können wir uns Zeit nehmen für Gespräche darüber, weshalb Deutschland in der Welt ausgelacht wird wegen des inkompetenten Verhaltens deutscher Politikerinnen. Oder Fridays For Future im Osten Thüringens.

Die Wanderer kommen und gehen, die Sonne zieht sich zurück. Yvonne wirft, entgegen unserer Vereinbarung, erst am Ende unserer Reise zu werfen, schon jetzt einen Blumenstrauß. In den letzten Tagen hatte sie unbändige Wut empfunden. Das ist gut, das Vorgenommene immer wieder zu durchkreuzen. Gegen sieben packen wir, beschauen auf unseren Smartphones die ersten Ergebnisse der Kommunalwahlen, der ersten von drei Wahlen in diesem Jahr hier, die Frage, wie sich Wut in Stimmen überträgt.
Eisenberg. 8.6.2024 | Stadtfest

Eisenberg, Stadtfest, strahlender Sonnenschein. Aufbau beim Schloss, im Garten, beim Bogengang. Idylle, die statte Wiese, die blühenden Blumen, das hergerichtete Gebäude, lockende Weinstände, plätschernde Brunnen, auf Stelzen schwebende Elfen, die Stadtfestbesucher in bester Laune. Ein idealer Ort also, um über Wut zu sprechen. Bei unserem Platz unter dem Bogengang stehen sich zwei Drehorgelspiegel gegenüber. Abwechselnd drehen sie die Orgel, Liebeskummer lohnt sich nicht oder Atemlos durch die Nacht. Unser Aufbau erfolgt routiniert.
Schnell merken wir, dass es nicht einfach wird: Wer in bester Laune ist, schaut mal interessiert auf das Banner, aber sprechen … eher nicht. So haben wir heute drei ausführliche Gespräche, mehrere kürzere, zwei Tafelschreibungen und nur einen Wurf.

Die Gespräche aber. Eins über private Wut. Zwei, die jene Wut thematisieren, wegen der wir vermutlich aufgebrochen sind. Die großen Wutthemen dieser Zeit – Migration, Krieg, Inflation, Sprechverbote – jeweils in dreißig Minuten, ruhig, aber bestimmt das Formulieren über Goldstücke, Rüstungsindustrie und Klimakleber. Den Inhalt dieser Gespräche auf drei Schlagworte zu reduzieren heißt, die Erkenntnis dieser Gespräche nicht verstehen zu können. Was ein grundsätzliches Problem ist, auch des gesamten Projekts. Um zu verstehen, braucht es die Ausführlichkeit. Einen Satz stellvertretend rauszunehmen wäre wie eine reißerische Überschrift zu finden für einen eigenen, mindestens ambivalenteren Inhalt.
Ich bin noch dabei, meine Rolle in diesen Gesprächen zu finden. Klar, das Zuhören. Das Aufnehmen, das Protokollieren. Dennoch funktionieren ja Gespräche nicht ausschließlich so, dass einer redet und der andere danebensteht und ausschließlich zuhört. Man erwartet auch eine Reaktion vom Gegenüber – ein Nicken, ein Lächeln, eine zustimmende Geste oder zumindest einen Hinweis, dass ein Gedankenaustausch stattfinden könnte.

Doch wie effektiv? »Impulse« setzen für einen Themenwechsel? Einsteigen in eine inhaltliche Diskussion, wenn ich anderer Meinung bin? Dann Argumente vortragen, Dinge benennen, Sachverhalte anders darlegen? Ist das meine Funktion in den Wutgesprächen? Ebenfalls bemerke ich, dass es mir leichter fällt, in ein Gespräch zu kommen, wenn ich und der Gegenüber ähnliche Ansichten haben. Ist das nicht der Fall, liegen unsere Sichten auf die Welt diametral auseinander, sage ich weniger. Weil: Was denn? Eine Gegenrede starten? Zustimmen, obwohl ich nicht zustimmen kann? Nur dort zustimmen, wo es Überschneidungen gibt? Und wenn diese vorhanden sind: Was interessiert mich dann am Gespräch? Abhaken von eigenen Ansichten? Das Einsammeln von Wutthemen. Wie geht mein Gegenüber damit um?
Yvonne geht das Ganze viel natürlicher an, instinktiver. Das bewundere ich. Ich merke, dass ich erst beim vierten Wurf beginne zu verstehen, was es hier zu verstehen geben könnte. Muster erkenne und sich daraus neue Fragen ergeben. Wenn alle schimpfen, weil alles aus dem Lot geraten ist, wie gerät es wieder ins Lot? Wird man, wenn genug geschimpft ist, wieder weniger schimpfen? Oder wird es – so die Erwartung in einem Gespräch – zu einem Knall kommen, einer eskalierenden Entladung des Aufgestauten?

Einmal gehe ich hinein die Stadt, auf den Marktplatz von Eisenberg. Der unverwüstliche Langosstand, ein heimischer DJ mixt sehr laut sehr harte 909 Beats, Pulled Pork, Bierbänke. Auf der Bühne singt ein Alleinunterhalter Elvis Presley. Eine Frau dreht selbstbewusst Runden, trägt rotes T-Shirt mit weißer Kreisfläche, in der steht: »Symbole kann man verbieten. Ideale nicht.« Eindeutig, welches Symbol hier fehlt.
Stadtfeste in Kleinstädten, ich war auf einigen, immer auch feindliches Gebiet. Die Wut ist hier, ein Zentrum. Die Wut ist da. Und nun? Was müsste geschehen, damit die Wut geht? Alle Faulen in Arbeit? Alle Politiker in Sackleinen? Alle unsinnigen Ämter abgeschafft? Alle ungerechten Steuern gesenkt? Alle Nichtautochthonen in die Wüste? Frieden? Für wen? Ja. Was endet die Wut? Oder ist diese Wut nur typischer Ärger und wir nennen sie aus künstlerischen Gründen »Wut«?

Gegen sieben packen wir ein, ich, weiterhin suchend, unschlüssig, im Bogengarten bei dem plätschernden Brunnen und den Drehorgeln beunruhigter als zuvor.
Eichstruth. 9.6.2024 | Europawahl

Eichstruth war das erste Dorf, das wir für Jenseits der Perlenkette besuchten. Im Eichsfeld gelegen, ein Ort, an dem wir uns wohl und willkommen fühlen. Es ist der Sonntag der Europawahl. Das kleine Dorf hat darum gekämpft, ein eigenes Wahllokal haben zu können, um für die Wahl nicht ins Nachbarort fahren zu müssen. Vor dem selbstgebauten Gemeindehaus, neben der Feuerwehr und Spielplatz, vor dem Friedhof bauen wir unsere Tafeln auf. Zuerst Begrüßungen, irgendwie strahlen wir alle, freuen uns, einander wiederzusehen. Zuletzt waren wir vor zwei Jahren hier, um die Kirchenglocken zu schlagen und den Klang für eine Ausstellung zu beschreiben.
Im Gemeindehaus befindet sich das Wahllokal. Wer dort als Wahlhelfer sitzt, sitzt den Tag über. Pizzen werden vorbeibracht, Flammkuchen, man setzt sich dazu, trinkt etwas zusammen, plauscht. Und gibt dabei seine Stimme ab, eine Stimme von etwa siebzig im Dorf, eine von 450 Millionen.

Die Person, die damals bei der Perlenkette das Eis mit uns brach, begibt sich auch heute zuerst in ein Gespräch. Sie spricht über die Gemeinde, das Aufgeben der Selbstständigkeit, den Verlust des Namens, die Wut darüber, dass sich demokratische Institutionen nicht an Vereinbarungen hielten. Sie hat damals an alle Türen im Dorf geklopft, um alle zum Wählen zu bringen. Wer etwas über Mitbestimmung und Selbstermächtigung lernen will, der muss an diesem Nachmittag in Eichstruth sein und zuhören.
Mühelos finden sich bis zum Nachmittag die nächsten Wutgäste. Im Unterschied zu Eisenberg gibt es kein Ringen um einen Austausch. Vertrauen ist da. Uns wird ein großes Geschenk gemacht; neun Gespräche, die ein gewaltiges Spektrum an Wut abdecken. Es fühlt sich anders an als tags zuvor. Vielleicht ist es die Wahl, die stattfindet, trotz der unterschiedlichen Meinungen das Sitzen und Sprechen. Am Auffälligsten das Paar, in dem er AfD wählt, weil er so unzufrieden ist mit Politik und sie auch unzufrieden ist, aber niemals AfD wählen würde, weil ihr Vater in Auschwitz und Buchenwald war. Wie wir das einmal montieren werden…
Wir fahren zurück und könnten noch zwei Tage hier verbringen, werden sicher wiederkommen, zuhören, lernen.
Bad Frankenhausen. 18.6.2024 | Bauernkriegspanoramafeeling

Man hatte uns gesagt, Dienstag wäre Markttag. Doch als wir am Dienstag auf dem Markt von Bad Frankenhausen ankommen, ist kein Wochenmarkt. Wochenmarkt war früher einmal dienstags gewesen, erfahren wir von einer Blumenverkäuferin, Wochenmarkt ist nun donnerstags.
Auch egal. Einmal hier, bauen wir auf, trotzdem natürlich. Die Tafel stellen wir so, dass sie, fotografieren wir sie, zentriert unter dem Fassadenschriftzug des Rathauses steht. Denn uns gegenüber befindet sich das Rathaus, ein symbolisches Bild damit. Dazwischen der große, leere Platz mit stillem Brunnen, dessen Nichtfunktionieren später auch Anlass für Wut sein wird: Dinge, die funktionieren könnten und deren Mängel leicht zu beheben wären und die nicht behoben werden. Stattdessen ist ihr Mangel für alle offensichtlich, mitten im Zentrum eines Orts. Ein Gleichnis, wie Viele viele Fehler im System wahrnehmen.

Es ist klar, dass wir bald den Schatten, in dem wir uns niedergelassen haben, verlieren werden. Die Sonne wird wandern und wir werden in prallen 25° sitzen. Um uns intensiver Fischgeruch. Bad Frankenhausen liegt am Meer. Zumindest am Bauernkriegspanorama, das zwei Kilometer entfernt posiert. Wir erfahren auch so einiges über die Stadt.
Jeder Blick darauf ist verschiedenen. Einer, den es nach der Wende hierher verschlug, ist voll des Lobes. Keine Wut hier, wenig Probleme, dadurch, dass Bad Frankenhausen immer schon Kurstadt war, seien es die Menschen gewohnt, freundlich mit Menschen umzugehen, gerade mit denen von außen, haben damit ihr Geld gemacht, anders als in Artern, als in den 1990ern Jahren gleich die Industrie wegbrach.
Eine nächste Stimme erzählt, wie Anfang der 90er die Knopffabrik geschlossen wurde, 500 Arbeitsplätze weg, erst nach und nach verstanden die Menschen, dass diese Zeit nicht wiederkommt. Dafür vier Jeansläden nach der Wende eröffnet, doch die Leute kauften die Jeans mit dem Begrüßungsgeld lieber im Westen. Wut, wird dabei klar, ist immer auch Erinnerung.

Eine weitere Stimme erzählt von der Wut montags auf den Spaziergängen, Wut gerichtet an Annalena Baerbock. Darüber kommen wir darauf zu sprechen, was eigentlich der Gegenstand unserer Beschäftigung sein kann. Wenn wir montags die Wut in Bad Frankenhausen gegen Selenskyj oder die Außenministerin richten, werden wir dann überhaupt gehört werden können? Von wem? Scheren sich denn die Kriegstreiber da oben um Bad Frankenhausen? Ist montags also ein Ventil für Wut? Ist montags Selbstbestätigung? Wie produktiv ist eine solche Wutentäußerung? Wie ginge es, die Wirksamkeit des eigenen Tuns zu erfahren? Wie läuft das im Lokalen? Bringe ich die Außerministerin zum Rücktritt, bringe ich den Brunnen wieder zum Laufen?
Das Fass mit Unzufriedenheit ist am Überlaufen, sage ich an einer Stelle. Aber ist das so? War nicht immer schon Unzufriedenheit vorhanden? Ärger, Schimpfen, Beschwerden, Fluchen? Vieles davon berechtigt? Hat sich verändert, wie wir darüber sprechen? Dass nun mehr Akteure Interesse daran haben, ein großflächiges Bild von Wut zu zeichnen und damit Kanäle zu bespielen? Und dieses Bespielte räsoniert mit der Unzufriedenheit, die seit Jahrhundert an Kaffee- und Stammtischen geäußert wird, Endlosspiegelungen in Spiegeln.

In Bad Frankenhausen sprechen wir nur mit Männern. Manche lesen das Banner und setzen sich ohne Umschweife zu uns. Sie verstehen sofort, dass sich hier reden lässt. Dass ihnen hier zugehört wird. Sie haben die Zeit dafür, sie haben ausreichend Worte. Die Frauen, die Yvonne anspricht, sie wollen nicht, sie haben Skrupel, sie haben Termine, sie müssen einkaufen, schieben das Kindergartenkind von der Eingewöhnung nach Hause, es ist gerade eingeschlafen.
Während wir über Wut sprechen, wird geheiratet. Ein Paar schneidet sich durch ein Bettlaken, sägt einen Stamm, Luftballons fliegen, Konfetti knallt. Uns gegenüber am Rathaus findet das Glück statt. Zwei Pole. In den Tagen zuvor hat jemand gefragt, was das Gegenteil von Wut sei. Ist es die Liebe? Nach dem Mittag fahren wir weiter, sind mehrere Stunden in der Sonne gewesen.

Meusebach. 18.6.2024 | Gewitterzellen

Unwetter sind angekündigt, Starkregen, Hagelkörner groß wie das Saarland Tennisbälle, Tornados. Nur wann? Und wo werden sich die Zellen entladen?
Wir hoffen, nicht über Meusebach. Meusebach, ein weiteres Heimspiel. Einer der Orte, an dem wir für die Perlenkette einst waren, ein kleines Dorf, verwunschen gelegen, eingeklemmt zwischen Hügeln, im Tal die Fachwerkhäuser, Fischteich, ein prächtiger Tulpenbaum. Hier kennen wir die Leute und deshalb sind wir da, wie letztens schon Gespräche, in denen wir nicht erst langwierig Vertrauen aufbauen müssen.
Wir bauen uns auf, direkt von der Spatzenjägerhalle, ein Gemeindehaus, gemeinsam gebaut vom Dorf. Der Name ist Teil der dörflichen Mythologie. Meusebach ist das Dorf ohne Spatzen, deshalb Spatzenjägerhalle. Yvonne hat einen Kuchen gebacken, weil sie diesmal diejenige sein will, die für Speis sorgt. Ansonsten werden wir hier immer versorgt. Das geht nur halb auf, weil wir hier dennoch Kuchen gereicht bekommen, überbackenen Toast, Bier, Radler, Wein. Auf dem Dorf immer Vollpflegung.

So ist unser Gesprächstisch zuerst einmal ein Tisch, der Essen trägt. Mit dem Essen werden Neuigkeiten ausgetauscht, Tratsch, Gerüchte, Biografisches. Es fällt nicht leicht, von da aus zur Wut zu wechseln, das merken wir schnell. Meusebacher kommen, schauen neugierig, bleiben stehen, sind im Gespräch dabei, dies und das und irgendwie die Wut. Das, was wir sonst machen – im kleinen Kreis konzentriert über einen festgelegten Zeitraum intensiv und privat über Wut zu sprechen – ist hier nur halb möglich.
Wir sprechen über den russischen Angriffskrieg und einer aus der Runde fragt nach dem Wetter und dann reden wir eben erstmal übers Wetter. So was geschieht öfter. Das ist nicht schlimm, so sind eben normale Gespräche, wie man sie führt. Und doch ist es wieder zielführend: zu beobachten, wie Themen wie Krieg oder »Ist Ramelow ein guter MP« oder »Ausländer« innerhalb einer Gruppe verhandelt werden, wie unterschiedliche Positionen mit welchen Worten vertreten werden, wer sich wann in Rage redet, wer Argumente bringt, wie besänftigt wird, vermieden, zugespitzt, zugestimmt.
Denn: Die Themen sind ja da. Man lebt gemeinsam an einem Ort und kann sich nicht komplett in die Wut begeben, die man empfindet über das, was weit weg geschieht und deshalb außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegt. Man muss untereinander zurechtkommen. Auch in Sachen Wut.

Zugleich hören wir die Geschichten mit den kleinen Nickligkeiten des Alltags. Darin wird die Wut konkreter, hat deutlichere Konsequenzen für das Leben. Die Gesprächsgruppen wechseln. Wir haben mit Konkurrenz zu kämpfen. Kürzlich wurde eine silberne Hochzeit gefeiert, deshalb werden seit Tagen Fichtenzweige gebunden. Das Paar stellt Essen und Trinken bereit und im Laufe einer Woche kommen die Bewohner und sitzen zusammen, essen, trinken, binden. Das ist wichtiger als das Blumenwerfen, wichtiger als Wut. Es ist einfach zu viel los in Meusebach.
Nach dem Abendbrot – wieder ein Umfunktionieren des Tischs – fahren wir los, geraten hinter Jena in die angekündigte Gewitterzelle. Es hagelt Tennisbälle. Wetterleuchten, Blitze zucken sekündlich, LKWs überholen unbeirrt. Wir flüchten uns unter das Dach einer Tankstelle, warten das Wüten des Unwetters ab.

Abends. 18.6.2024 | die FDP wirbt werfend

Am Abend die Nachricht, wie der Thüringer Landesverband mit neuer Kampagne für die Landtagswahl wirbt: mit dem Blumenwurf. Das Motiv: Die Füße von Thomas Kemmerich, davor ein Blumenstrauß, dazu steht »Zurückgetreten, um Anlauf zu nehmen.«
Ich bin befremdet. Weil diese Kampagne grundsätzliche Zweifel befeuert. Gleich beim ersten Blumenwurftermin sagte eine Teilnehmerin, dass sie es seltsam finde, wie wir diese kleine Sache symbolisch überhöhen. Und ja, so ist es. Wir nehmen eine konkrete Aktion und nutzen sie zu einem Zweck. Aber es ist nicht unsere Aktion. Die Aktion ist belegt mit Geschichten und Symbolen. Sie gehört allen. Und wir machen ein Prinzip daraus.
Anfang Juni hätten wir im Landtag werfen lassen können. Auch Thomas Kemmerich hatte angekündigt, Blumen werfen zu können. Wir kennen ihn von Dreharbeiten. Einerseits: Es ist Kunst. Einer der tatsächlichen Akteure wird Teil der Performance. Ein Resonanzraum der Möglichkeiten. Dazu die Aufmerksamkeit: Jetzt wirft Kemmerich selbst Blumen.
Dagegen das Gefühl, dass wir mit unserer Aktion ihm die Möglichkeit schaffen, eine Geste der Wut umzudeuten. Der Beworfene wird zum Werfenden. In welcher Funktion würde er werfen? Als Bürger? Als Politiker? Als Künstler? Es wäre naiv zu glauben, dieses Zurückwerfen wäre kein Symbol.
Viele werden es ungehörig finden, dass Thomas Kemmerich diese Geste, die gegen ihn gerichtet war, für sich nutzt. Aber aus unseren Terminen wissen wir, dass die Kampagne seines Landesverbands hier auf Zustimmung treffen wird. Die in Thüringen, jene, an die diese Kampagne gerichtet ist, werden auch nicken. Viele zwischen Eisenach und Greiz fanden den Wurf unanständig, ehrverletzend, undemokratisch, respektlos. Das ist die Ambivalenz. Müssen wir sie aushalten? Was ist unser Anteil daran? Was befördern wir, wann können wir uns zurückziehen und sagen »Kunst darf alles«?
Weimar. 22.7.2024 | Gorilla zum
Abschluss

Vorerst ein letzter Wurf. Die Entscheidung fällt auf Weimar. Beim ersten Wurf war die Liste derjenigen, der mitwerfen wollten, lang. Viele konnte damals nicht dabei sein. Das wollen wir nachholen. Außerdem wollen wir erweitern. Bisher waren zu wenig Werfende unter 30. Das möchten wir ändern. Auch wenn der Blumenwurf keine wissenschaftliche Studie sein soll, nicht repräsentativ kann … ein bisschen mehr Spektrum wäre schön.
So bauen wir wieder an dem heißen Sonntag Objekt – Tisch – Technik auf einer Wiese auf. Ein Schafgarbenmeer, weiße Korbblütler, zwischen die heute Kreidestaub fallen wird. Sonne weigert sich, hinter Wolken zu verschwinden. Wir spannen Schirme auf und reiben die Haut mit Schutz ein und hören zu. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig sich auch nach siebzig Gesprächen wiederholt, wie viele neue Geschichten und Gedanken wir erfahren.
Als Thomas Kemmerich kommt, beginnt es irgendwann zu donnern. Ein Gespräch mit spezieller Bedeutung, er ist ein Protagonist des ursprünglichen Blumenwurf. Susanne Hennig-Wellsow hatten wir ebenfalls angefragt. Ein Termin war ausgemacht, wurde abgesagt. Ein Bedauern darüber, weil so eine wichtige Perspektive fehlen wird. Eine Leerstelle.
Mit Thomas Kemmerich wollen wir nicht über Tagespolitik sprechen, sondern über den Wurf an sich; Ablauf, Gedanken, Bilder. Und auch wenn der Wurf medial schon ausgeleuchtet ist, besteht auch die Absicht, etwas zu Tage zu fördern aus dem Erinnerungsbergwerk Kemmerichs, das bisher noch nicht im Licht war. Und wie das so ist bei Gesprächen: Man bereitet sich vor, überlegt Fragen und bräuchte doch mittendrin eine Pause von fünfzehn Minuten, um das bisher Gesagte zu bedenken und daraus neue Fragen zu formulieren, eine Auszeit, um mit Abstand von vorn zu beginnen und sich nicht mitnehmen zu lassen von den Momenten, die ein Gespräch immer so ausmacht.

Danach beginnt der Regen. Ortswechsel, einer von mehreren an diesem Tag. Drinnen, draußen, Wasser, Brüten, Tropfen, Sturm – viele Zustände. Die Zeitfenster haben wir diesmal großzügiger bemessen, was gut ist, weil sich die Gespräche so ausweiten können.
Wir sprechen über die Unterschiede zwischen Ärger – Wut – Hass. Darüber, wie mit Wut umgehen, deren Ursachen weit außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Sprechen über Akzeptanz. Indische Mediationstechniken und einander wütend anbrüllen als Konzept. Eine junge Frau aus der Ukraine erklärt, weshalb sie keine Wut verspürt. Oft geht es um den persönlichen Umgang mit Wut, um Privates. Politik ist etwas, das wir eher im letzten Drittel eines Gesprächs aufrufen. Wenn, dann kommt die Rede auch auf das Parteiensystem und der Wunsch nach Änderungen an der politischen Teilhabe, nach Bürgerräten.
Auch beim Werfen Abwandlungen. Blumen ablegen, zwei Sträuße werfen, sich vor die Tafel setzen und schweigen, wütend das Hemd vom Körper reißen und weil wir zuvor über Trump sprachen: als Gorilla mit Kreide Ausrufezeichen in den Schiefer hämmern. Die Gespräche fließen ineinander, damit die Themen, nehmen Bezug aufeinander. Thomas Kemmerich spricht über El Hotzo und später sprechen wir wieder darüber, gehen über zu Selbstjustiz aus Folge von Wut, über die Justiz als Instanz, die Folgen von Wut bewertet.

Unmöglich, Abstand zu gewinnen. Zu erfassen, was uns gesagt wird. Immer weiter, immer neue Gespräche, Gedanken, Perspektiven, Erlebtes. Wenn ich je wieder höre, dass jemand für sich in Anspruch nimmt, für »die Bürger« zu sprechen oder glaubt zu wissen, wie »die Leute« oder was »das Volk« eigentlich will, dann kann ich diese hunderten Seiten Gesprächsmitschriften geben und sagen: Dieses verlockende Wir ist sehr viel komplexer, als man glauben möchte.
Nahezu zwölf Stunden sind wir an diesem Tag in der Wut, auch ein Rausch, darin so versinken zu dürfen. Am Ende ein bedrückendes Gespräch mit einem aus Palästina stammenden Weimarer. Er sagt, die Wut ist nicht nur viel sichtbarer als früher, sie ist auch legitimierter, gewünschter.
Wie bringt man all diese vielen Eindrücke zusammen? Ein weiterer Tag, so viele Stunden, die allein schon den Platz bestücken könnten. Das wird das Nächste sein: die Gespräche transkribieren. Wird der Blumenwurf damit beendet sein? Wie ein Ende fühlt es sich nicht an, noch lange nicht.

Weimar. Sommer / Herbst 2024 | Der lange Weg zur Wut
Ende Juli der letzte Wutwurf. Und jetzt? Die KI bringt das Audio der Gespräche in erste Worte. Dann beginnt die genaue Überarbeitung. Alles abhören, korrigieren, ergänzen, streichen, vervollständigen. Dabei überlegen, wie der Sprechtext in einen Lesetext überführt werden kann. Das Gesprochene ist oft nicht lesbar: voller ähs, ohs, sowiesos, sozusagens. Voller Abbrüche, unvollständiger Sätze, Gedanken, die im Nirgendwo enden, Themen, die einfach versanden.
Bei jedem ist das so, auch bei uns, den Fragenden. So ist es bei mir. So spreche ich. Ich höre mir zu, wie ich spreche. Und weil das Sprechen so vermeintlich nah am Denken ist, denke ich auch so. Denke ich auch so? Unvollständig, in Ellipsen, voll von Widersprüchen, Wiederholungen? Es ist auch eine Reise in die Finsternis, dieses Ohr so nah an der eigenen Stimme, so nahe am Ich.
Aber das ist ohne Belang für andere. Wichtig ist: Was davon lässt sich lesen? Wie viel Text-Anpassung ist für ein allgemeines Verständnis notwendig? Wie oft müssen wir in die Sätze eingreifen? Wann ist die Form des Gesprochenen wichtiger als der Inhalt, wann ist die Thüringische Zunge unverzichtbar, wann sagt ein ge mehr als zehn Argumente? So viele Entscheidungen sind zu fällen. Auf etwa siebenhundert Seiten kommen wir am Ende: So viele Worte haben die Gespräche über die Wut gebracht.
Diese Form der Transkription als ein elementarer Bestandteil des Wurfs. Zäh und langwierig, aber so notwendig. Noch einmal eintauchen in das Gehörte und Ausgetauschte, verstehen, wie Gedanken flossen, auch das eigene Sprechen nachvollziehen können. Ich denke, eigentlich sollte es so sein, dass jeder hin und wieder das eigene Sprechen aufzeichnet und dann abtippt, sich selbst dabei auf die Schliche kommen, die Leerstellen des eigenen Denkens und Argumentierens wahrnehmen.

Wir lesen das Transkribierte, wählen aus, ordnen zu, bringen in eine Reihenfolge, stellen Fotos daneben, spielen das so Montierte auf die Webseite aus. Was machen wir eigentlich? Was wir nicht machen: Journalismus. Literatur. Ethnologie. Soziologie. Empirische Kulturwissenschaft. Politik. Aktivismus.
Wir wollen keine Antworten liefen, keine Lösungsansätze vorschlagen, nichts vordergründig erklären, nichts belegen. Wir wollen zuhören, so wenig wie möglich einmischen, wir wollen sammeln und, als aktives Element, auswählen und montieren. Wir haben das »Ein Kunstprojekt« genannt, um möglichst wenig festzulegen. Was es tatsächlich sein wird, das wissen wir weiterhin nicht.
Wir weisen die Aussagen Kategorien zu, füllen sie dorthin. Aus drei Kategorien werden am Ende dreizehn. Politik, den umfangreichsten Bereich, splitten wir in die Untergruppen Krieg und Migration. Wir wollen kürzen, wollen aussortieren, uns der Lesbarkeit wegen auf Weniges beschränken. Doch merken wir schnell, dass gerade in der Ausführlichkeit der eigentliche Zweck des Blumenwurfs liegen könnte. Es ist nicht möglich, Wut auf fünf Zitate zu reduzieren und damit eine Aussage zu treffen.
Uns ist klar: Das vollständige Lesen aller Wutkategorien ist eine Überforderung. Außer uns wird niemand das tun. Und so soll es sein, ist unsere These. Sich in Auszügen hinzuzugeben, weil man sich auch außerhalb dieser Seite nur in Auszügen in etwas hineinbeginnt. Und wer sich doch ausführlicher tut, ist näher dran an den Eindrücken, die wir sammelten.
Parallel zu dieser Arbeit laufen Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm von Yvonne und Wolfgang, bei dem ich wochenweise dabei bin. Zeit vergeht. Die Wahlen kommen und gehen, wenig ist klar, das Drehen nimmt sich die Tage, wir montieren nur sporadisch weiter. Haben das Gefühl, dass sich allmählich ein Zeitfenster schließt, dass die Wut weiterwandert, dass aus dem Einfangen der Gegenwart ein historisches Dokument wird. Doch die Vollständigkeit hat für uns in diesen Wochen die größere Bedeutung als die Aktualität. Wann wir damit nach außen gehen werden? Wir werden sehen.
Weimar. Dezember | Seil

Die letzten Wochen mit der Wut verbracht. Texte wieder und wieder gelesen, neue Kategorien schaffen müssen, zugeordnet, Korrekturstände hin- und hergeschickt, beraten. Das Online ausgebaut, eingefügt. Trennstriche setzen. Fotos auswählen, Fotos hinzusetzen, Fotos vergleichen, Fotos wieder rausnehmen, Textstellendopplungen entdecken, Fotodopplungen entdecken, Dopplungen entfernen, Leerstellen füllen, ersetzen. Sehr viele kleine Teile. Das große Ganze gerät aus dem Blick.
Ab und an verstehen, was wir gerade machen. Und auch Zweifel schleichen sich ein bei mir. Geht das in dieser Form? In der Ballung ist einiges schon hart, ich merke, wie beim Lesen mein Puls nach oben schnellt. Die montierte Komprimierung ist sinnvoll, weil sie etwas verdeutlicht. Und doch hoffe ich, dass die fraglichen Kategorien auch im Zusammenspiel begriffen werden, dass nicht missverstanden wird im Sinne von: So sind sie die Ossis die Dörfler die Urbanen die Männer die Frauen die Alten die Jungen. Oder: Wir kolorieren diskriminierende Positionen, reproduzieren eine fragliche Sprache. Oder, ebenso schlimm: Genauso ist es, endlich sagts mal jemand, die-da-oben, wir-hier-unten. Bitte kein Isso.
Eine Menge Fallstricke, die wir natürlich selbst gespannt haben. Jeder, der liest, kann sich den einen Satz aus der Montage reißen und damit machen, was er, was sie will. Und je mehr Sätze, desto mehr Reißmaterial. Das Netz unter dem Seil, das wir uns hier in den letzten Monaten geschaffen haben, fühlt sich in manchen Momenten recht löchrig an. Und das liegt nicht allein am Blick von außen. Wir liefern ja keinen Kontext. Machen nicht die Sprecherposition der einzelnen Aussage deutlich: Wer spricht da eigentlich, woher kommt sie, was ist seine Geschichte?, damit sich die Aussagen dadurch bewerten ließen. Wir ordnen zwar zu, aber nicht ein. Wir vertiefen nichts, fügen keinen Argumentationsapparat hinzu, zeigen keine Diskussionstradierungen auf. Wir widersprechen nicht. Jede Aussage isoliert, unser Kontext ist die Auswahl der Aussage und die Auswahl der Stelle, an der sie steht. Wir schaffen uns einen eigenen Kontext. Fallstricke also.
Und trotzdem: Es muss auch so sein. Und jetzt muss es auch mal fertig werden. Donnerstag haben wir als Datum dafür bestimmt. Puls schlägt, Blut pumpt, Nervosität.